Quelle: http://www.nzz.ch/2007/06/14/to/articleF80KA.html
Das klassische Bergsteigen als Auslaufmodell
Der Zeitgeist und neue Trends schaffen ein vielfältigeres Angebot in der Hochgebirgswelt
Die Berggipfel sind die gleichen wie vor 100 Jahren, die Übernachtungszahlen in den SAC-Hütten sind um ein Vielfaches gestiegen. Dennoch ist das Schlangestehen vor dem Gipfelkreuz nicht zum Alltag geworden. Das Interesse der Bergsteiger konzentriert sich auf einige wenige Modetouren, derweil andere Gipfel-Klassiker in Vergessenheit geraten.
Die Aiguille de la Tsa in den Walliser Alpen wurde zum letzten Berg von Hans Morgenthaler. Nicht dass dem Schriftsteller und irrlichternden Geist der helvetischen Bergsteigerszene etwas zugestossen wäre. Vielmehr setzte er seiner alpinistischen Karriere anschliessend an die Tour freiwillig ein Ende und schmiss seine Ausrüstung verärgert in eine Spalte des Glacier de Bertol. Die Berge waren ihm zu überlaufen geworden, der zunehmende Massenandrang im Hochgebirge hatte ihn vergrault. Man schrieb das Jahr 1920.
Starke Zunahme der Bergnutzung
Wie würde Hans Morgenthaler die Berge heute wohl erleben? Da das bergsteigerische Treiben in der Schweiz statistisch nicht umfassend erforscht ist, muss man sich anderweitig behelfen. Zwei Indikatoren aus dem Schweizer Alpenclub (SAC) können zumindest einen Hinweis liefern. Da ist zum einen der SAC-Mitgliederbestand, der sich seit Morgenthalers Zeiten etwa verzehnfachte. Vermutlich noch aussagekräftiger ist die Tatsache, dass sich die Übernachtungszahlen in SAC-Hütten gegenüber damals ebenfalls verzehnfachten. Es darf also davon ausgegangen werden, dass sich heute, rund 90 Jahre später, wesentlich mehr Leute in den Bergen tummeln - gegen zehnmal mehr.
Da sich die Anzahl Berge und die verfügbare Steh- und Sitzfläche auf ihren Gipfeln allerdings nicht in gleichem Masse vervielfacht haben, müsste mit mehr Andrang und Schlangestehen vor jedem Gipfelkreuz gerechnet werden. Dem ist jedoch nicht so - zumindest nicht überall. Gemäss Ueli Mosimann, Autor zahlreicher Führerwerke und seit 37 Jahren als Bergführer unterwegs, hat sich das Bergsteigen in den vergangenen Jahrzehnten eher «seitwärts» denn «aufwärts» entwickelt. Während sich die Leute auf berühmten Bergen tatsächlich oft auf den Füssen stünden, seien ehemals klassische und sehr beliebte Touren wie eine Überschreitung der Mittelgruppe in den Engelhörnern völlig in Vergessenheit geraten. Die Hochtourengeher scheinen sich stark auf die begehrten Viertausender und einige weitere wohlklingende Modetouren - Piz Palü, Mittellegi-Grat am Eiger, Blüemlisalp-Überschreitung - zu konzentrieren und die übrigen Berge recht konsequent zu verschmähen.
Ueli Mosimann, der sich als SAC-Sicherheitsfachmann immer wieder mit der Frage nach der Häufigkeit und Verteilung der Bergsteiger auseinandersetzen muss, beobachtet in den Schweizer Alpen zudem eine Verschiebung in den Nationalitäten. Waren vor einer Generation an einem Berg der Zinalrothorn-Kategorie (Viertausender, kombiniertes Gelände, nicht ganz einfach) in erster Linie Schweizer und Deutsche unterwegs, so seien heute an erster Stelle oftmals Holländer und Osteuropäer anzutreffen, von den einheimischen Bergführern einmal abgesehen.
Schnelle, bequeme Berge sind in
Was ist denn aus dem nationalen Breitensport (Sommer-)Bergsteigen geworden? Die Vermutung, die Schweizer hätten die Hochtouren nicht mehr nötig, weil schon gemacht, greift zu kurz - schliesslich kommt ja ständig Nachwuchs nach, der nicht schon auf allen Gipfeln gestanden ist. Der klimabedingte Rückgang der Gletscher und das Auftauen des Permafrosts, die zu heikleren Bedingungen und mehr Steinschlag führen, kommen als Erklärungsversuche schon eher in Frage; ebenso ein durch zahlreiche Aufklärungskampagnen gesteigertes und an sich positives Sicherheitsbewusstsein, das allerdings im einen oder anderen Fall vermutlich auch zu übertriebener Angst und völligem Verzicht führt. Bestimmt spielt auch eine neue Einstellung zur Freizeit eine Rolle: Das Mass der Freizeit ist der Tag. Was sich nicht als Tagestour erledigen lässt, und darunter fallen die meisten Hochtouren, wird zugunsten anderer Tätigkeiten geopfert.
Und vermutlich ist das klassische Bergsteigen, das manchmal etwas Schinderei abverlangt, hierzulande ganz einfach weniger en vogue als auch schon. Ruth Hofmeister, seit 1978 Hüttenwartin der Sciorahütte im Bergell, kann diesen Befund nur bestätigen. Die anspruchsvollen Granitberge rund um ihre Hütte - Sciora-Gruppe, Pizzo Cengalo, Pizzo Badile - gehörten einst zu den Meilensteinen jeder ernsthaften alpinistischen Laufbahn, doch das sei längst vorbei. Für Ruth Hofmeister ist die Ursache eindeutig: Zu beschwerlich seien die Touren für den heutigen Geschmack, zu lang, zu wenig abgesichert, zu kompliziert die Abstiege.
Ueli Mosimann sieht im hiesigen Bergsport zwei gegenläufige Entwicklungen: Einer erstaunlich breiten und aktiven Elite, die ihre Herausforderungen in sehr schwierigen Touren und ausserhalb der üblichen Hochtourensaison (Juli bis September) suche, stehe das Gros der Alpinisten entgegen, die sich eher den einfacheren Formen der Bergsteigerei wie Gletscherüberschreitungen oder leichten Firntouren zuwendeten. Auch Bergführer Jean Pierre Damerau, Geschäftsführer der Bergschule Uri, beobachtet eine starke Nachfrage bei den leichten Gletscherüberquerungen im Stile einer Haute Route. Allerdings sei bei den Gästen auch ein Trend hin zu mehr Komfort zu beobachten. Berge, die sich nicht von einem Hotel oder von einer gut ausgestatteten Hütte aus besteigen liessen, hätten es zunehmend schwerer.
Neue Trends
Viele Bergsteiger haben sich von der ehemaligen Königsdisziplin also abgewendet. Wo sind sie geblieben? Eine Breitenwirkung konnte das reine Felsklettern erzielen - besonders in der Ausprägung des sogenannten Plaisirkletterns mit seinen rasch erreichbaren, homogenen, gut abgesicherten und von alpinen Gefahren weitgehend freien Routen. Dorthin sind unübersehbar auch viele ehemalige Alpinisten abgewandert. Ebenfalls von Hochkonjunktur kann bei den Klettersteigen gesprochen werden, die besonders bei ambitionierten Wanderern und in die Jahre gekommenen Kletterern Anklang finden: Laut Schätzungen dürften die schweizweit rund 40 Anlagen im vergangenen Jahr etwa 35 000 Besuche auf sich vereint haben, Tendenz steigend. Für all jene, denen Plaisirklettern und Klettersteige zu steril, zu einseitig athletisch und ganz allgemein etwas abenteuerlos sind, existiert seit einigen Jahren eine weitere Alternative, das Alpinwandern (vgl. Kasten). Auf solche Rezepte greifen auch die Hüttenwarte zurück, um die ausbleibenden Bergsteiger zu ersetzen: mit dem Einrichten von Klettergärten und Klettersteigen oder mit dem Markieren alpiner Wanderrouten.
Wie würde Morgenthaler die Berge heute wohl erleben? Er würde blödsinnig überfüllte Regionen vorfinden, und er würde einsame Winkel erleben. Sein «letzter» Berg, die Aiguille de la Tsa, dürfte heute wesentlich einsamer sein als zu seinen Lebzeiten.
Marco Volken
Neuer Trend mit Retro-Geschmack
vol. Die erste weiss-blau-weisse Wegmarkierung der Schweiz ist 1991 am Passo di Cacciabella im Bergell angebracht worden. Die Farbkombination setzte sich rasch durch, versprach sie doch den Berggängern erhöhten Erlebnischarakter bei gesteigerten Schwierigkeiten. Im Jahr 1998 lancierte der SAC-Verlag unter dem damals noch ungebräuchlichen Begriff «Alpinwandern» eine Reihe von Wanderführern, die in die gleiche Stossrichtung zielen. Die darin beschriebenen Routen sprengen den herkömmlichen Begriff des Bergwanderns und locken in anspruchsvolleres, durchaus abenteuerliches Gelände. Der Erfolg dieser Reihe ist anhaltend, nicht zuletzt dank der Einführung einer neuen, von T1 bis T6 reichenden Skala zur Bewertung von Wanderschwierigkeiten.
Unter Alpinwandern (T4-T6) versteht man die Fortbewegung in oft weglosem, abschüssigem Gelände mit steilen Grashalden, Schrofen und Kletterstellen bis zum II. Grad, die Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, eine gewisse Geschicklichkeit, Erfahrung und guten Orientierungssinn erfordern. Apere Gletscher und Firnfelder können ebenfalls vorkommen. Schwierige Passagen lassen sich dabei - ähnlich wie auf klassischen Hochtouren - kaum mit Seil sichern, weshalb Misstritte rasch fatale Folgen nach sich ziehen.
Das Alpinwandern hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark ausgebreitet und teilweise kultartige Züge angenommen. So werden in Internet- Foren Erfahrungen ausgetauscht, und T6-Routen scheinen eine ähnliche, nahezu magische Anziehungskraft auszuüben wie einst der sechste Grad unter Kletterern. Die besten Alpinwanderer verstehen sich denn auch oft als eine etwas verschworene Elite auf der Suche nach Neuland. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass derartiges Gelände schon früher aufgesucht wurde - von Wildheuern, Jägern, Strahlern, Hirten, Schmugglern, aber auch von «altmodischen» Berggängern.
Um vom Alpinwander-Boom zu profitieren, markieren Verkehrsvereine und Hüttenwarte immer mehr solcher Routen, was bei vielen Hardcore-Alpinwanderern allerdings schlecht ankommt. Der Unterschied zwischen einer markierten und einer unmarkierten Route ist vergleichbar mit jenem zwischen einer Mode-Skitour, bei der man einfach einer vorhandenen Spur folgt, und einem frisch verschneiten Gelände, das man selbständig «lesen» muss und anspuren darf.
Quelle: http://www.nzz.ch/2007/06/14/to/articleF80KA.html
Das klassische Bergsteigen als Auslaufmodell
Der Zeitgeist und neue Trends schaffen ein vielfältigeres Angebot in der Hochgebirgswelt
Die Berggipfel sind die gleichen wie vor 100 Jahren, die Übernachtungszahlen in den SAC-Hütten sind um ein Vielfaches gestiegen. Dennoch ist das Schlangestehen vor dem Gipfelkreuz nicht zum Alltag geworden. Das Interesse der Bergsteiger konzentriert sich auf einige wenige Modetouren, derweil andere Gipfel-Klassiker in Vergessenheit geraten.
Die Aiguille de la Tsa in den Walliser Alpen wurde zum letzten Berg von Hans Morgenthaler. Nicht dass dem Schriftsteller und irrlichternden Geist der helvetischen Bergsteigerszene etwas zugestossen wäre. Vielmehr setzte er seiner alpinistischen Karriere anschliessend an die Tour freiwillig ein Ende und schmiss seine Ausrüstung verärgert in eine Spalte des Glacier de Bertol. Die Berge waren ihm zu überlaufen geworden, der zunehmende Massenandrang im Hochgebirge hatte ihn vergrault. Man schrieb das Jahr 1920.
Starke Zunahme der Bergnutzung
Wie würde Hans Morgenthaler die Berge heute wohl erleben? Da das bergsteigerische Treiben in der Schweiz statistisch nicht umfassend erforscht ist, muss man sich anderweitig behelfen. Zwei Indikatoren aus dem Schweizer Alpenclub (SAC) können zumindest einen Hinweis liefern. Da ist zum einen der SAC-Mitgliederbestand, der sich seit Morgenthalers Zeiten etwa verzehnfachte. Vermutlich noch aussagekräftiger ist die Tatsache, dass sich die Übernachtungszahlen in SAC-Hütten gegenüber damals ebenfalls verzehnfachten. Es darf also davon ausgegangen werden, dass sich heute, rund 90 Jahre später, wesentlich mehr Leute in den Bergen tummeln - gegen zehnmal mehr.
Da sich die Anzahl Berge und die verfügbare Steh- und Sitzfläche auf ihren Gipfeln allerdings nicht in gleichem Masse vervielfacht haben, müsste mit mehr Andrang und Schlangestehen vor jedem Gipfelkreuz gerechnet werden. Dem ist jedoch nicht so - zumindest nicht überall. Gemäss Ueli Mosimann, Autor zahlreicher Führerwerke und seit 37 Jahren als Bergführer unterwegs, hat sich das Bergsteigen in den vergangenen Jahrzehnten eher «seitwärts» denn «aufwärts» entwickelt. Während sich die Leute auf berühmten Bergen tatsächlich oft auf den Füssen stünden, seien ehemals klassische und sehr beliebte Touren wie eine Überschreitung der Mittelgruppe in den Engelhörnern völlig in Vergessenheit geraten. Die Hochtourengeher scheinen sich stark auf die begehrten Viertausender und einige weitere wohlklingende Modetouren - Piz Palü, Mittellegi-Grat am Eiger, Blüemlisalp-Überschreitung - zu konzentrieren und die übrigen Berge recht konsequent zu verschmähen.
Ueli Mosimann, der sich als SAC-Sicherheitsfachmann immer wieder mit der Frage nach der Häufigkeit und Verteilung der Bergsteiger auseinandersetzen muss, beobachtet in den Schweizer Alpen zudem eine Verschiebung in den Nationalitäten. Waren vor einer Generation an einem Berg der Zinalrothorn-Kategorie (Viertausender, kombiniertes Gelände, nicht ganz einfach) in erster Linie Schweizer und Deutsche unterwegs, so seien heute an erster Stelle oftmals Holländer und Osteuropäer anzutreffen, von den einheimischen Bergführern einmal abgesehen.
Schnelle, bequeme Berge sind in
Was ist denn aus dem nationalen Breitensport (Sommer-)Bergsteigen geworden? Die Vermutung, die Schweizer hätten die Hochtouren nicht mehr nötig, weil schon gemacht, greift zu kurz - schliesslich kommt ja ständig Nachwuchs nach, der nicht schon auf allen Gipfeln gestanden ist. Der klimabedingte Rückgang der Gletscher und das Auftauen des Permafrosts, die zu heikleren Bedingungen und mehr Steinschlag führen, kommen als Erklärungsversuche schon eher in Frage; ebenso ein durch zahlreiche Aufklärungskampagnen gesteigertes und an sich positives Sicherheitsbewusstsein, das allerdings im einen oder anderen Fall vermutlich auch zu übertriebener Angst und völligem Verzicht führt. Bestimmt spielt auch eine neue Einstellung zur Freizeit eine Rolle: Das Mass der Freizeit ist der Tag. Was sich nicht als Tagestour erledigen lässt, und darunter fallen die meisten Hochtouren, wird zugunsten anderer Tätigkeiten geopfert.
Und vermutlich ist das klassische Bergsteigen, das manchmal etwas Schinderei abverlangt, hierzulande ganz einfach weniger en vogue als auch schon. Ruth Hofmeister, seit 1978 Hüttenwartin der Sciorahütte im Bergell, kann diesen Befund nur bestätigen. Die anspruchsvollen Granitberge rund um ihre Hütte - Sciora-Gruppe, Pizzo Cengalo, Pizzo Badile - gehörten einst zu den Meilensteinen jeder ernsthaften alpinistischen Laufbahn, doch das sei längst vorbei. Für Ruth Hofmeister ist die Ursache eindeutig: Zu beschwerlich seien die Touren für den heutigen Geschmack, zu lang, zu wenig abgesichert, zu kompliziert die Abstiege.
Ueli Mosimann sieht im hiesigen Bergsport zwei gegenläufige Entwicklungen: Einer erstaunlich breiten und aktiven Elite, die ihre Herausforderungen in sehr schwierigen Touren und ausserhalb der üblichen Hochtourensaison (Juli bis September) suche, stehe das Gros der Alpinisten entgegen, die sich eher den einfacheren Formen der Bergsteigerei wie Gletscherüberschreitungen oder leichten Firntouren zuwendeten. Auch Bergführer Jean Pierre Damerau, Geschäftsführer der Bergschule Uri, beobachtet eine starke Nachfrage bei den leichten Gletscherüberquerungen im Stile einer Haute Route. Allerdings sei bei den Gästen auch ein Trend hin zu mehr Komfort zu beobachten. Berge, die sich nicht von einem Hotel oder von einer gut ausgestatteten Hütte aus besteigen liessen, hätten es zunehmend schwerer.
Neue Trends
Viele Bergsteiger haben sich von der ehemaligen Königsdisziplin also abgewendet. Wo sind sie geblieben? Eine Breitenwirkung konnte das reine Felsklettern erzielen - besonders in der Ausprägung des sogenannten Plaisirkletterns mit seinen rasch erreichbaren, homogenen, gut abgesicherten und von alpinen Gefahren weitgehend freien Routen. Dorthin sind unübersehbar auch viele ehemalige Alpinisten abgewandert. Ebenfalls von Hochkonjunktur kann bei den Klettersteigen gesprochen werden, die besonders bei ambitionierten Wanderern und in die Jahre gekommenen Kletterern Anklang finden: Laut Schätzungen dürften die schweizweit rund 40 Anlagen im vergangenen Jahr etwa 35 000 Besuche auf sich vereint haben, Tendenz steigend. Für all jene, denen Plaisirklettern und Klettersteige zu steril, zu einseitig athletisch und ganz allgemein etwas abenteuerlos sind, existiert seit einigen Jahren eine weitere Alternative, das Alpinwandern (vgl. Kasten). Auf solche Rezepte greifen auch die Hüttenwarte zurück, um die ausbleibenden Bergsteiger zu ersetzen: mit dem Einrichten von Klettergärten und Klettersteigen oder mit dem Markieren alpiner Wanderrouten.
Wie würde Morgenthaler die Berge heute wohl erleben? Er würde blödsinnig überfüllte Regionen vorfinden, und er würde einsame Winkel erleben. Sein «letzter» Berg, die Aiguille de la Tsa, dürfte heute wesentlich einsamer sein als zu seinen Lebzeiten.
Marco Volken
Neuer Trend mit Retro-Geschmack
vol. Die erste weiss-blau-weisse Wegmarkierung der Schweiz ist 1991 am Passo di Cacciabella im Bergell angebracht worden. Die Farbkombination setzte sich rasch durch, versprach sie doch den Berggängern erhöhten Erlebnischarakter bei gesteigerten Schwierigkeiten. Im Jahr 1998 lancierte der SAC-Verlag unter dem damals noch ungebräuchlichen Begriff «Alpinwandern» eine Reihe von Wanderführern, die in die gleiche Stossrichtung zielen. Die darin beschriebenen Routen sprengen den herkömmlichen Begriff des Bergwanderns und locken in anspruchsvolleres, durchaus abenteuerliches Gelände. Der Erfolg dieser Reihe ist anhaltend, nicht zuletzt dank der Einführung einer neuen, von T1 bis T6 reichenden Skala zur Bewertung von Wanderschwierigkeiten.
Unter Alpinwandern (T4-T6) versteht man die Fortbewegung in oft weglosem, abschüssigem Gelände mit steilen Grashalden, Schrofen und Kletterstellen bis zum II. Grad, die Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, eine gewisse Geschicklichkeit, Erfahrung und guten Orientierungssinn erfordern. Apere Gletscher und Firnfelder können ebenfalls vorkommen. Schwierige Passagen lassen sich dabei - ähnlich wie auf klassischen Hochtouren - kaum mit Seil sichern, weshalb Misstritte rasch fatale Folgen nach sich ziehen.
Das Alpinwandern hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark ausgebreitet und teilweise kultartige Züge angenommen. So werden in Internet- Foren Erfahrungen ausgetauscht, und T6-Routen scheinen eine ähnliche, nahezu magische Anziehungskraft auszuüben wie einst der sechste Grad unter Kletterern. Die besten Alpinwanderer verstehen sich denn auch oft als eine etwas verschworene Elite auf der Suche nach Neuland. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass derartiges Gelände schon früher aufgesucht wurde - von Wildheuern, Jägern, Strahlern, Hirten, Schmugglern, aber auch von «altmodischen» Berggängern.
Um vom Alpinwander-Boom zu profitieren, markieren Verkehrsvereine und Hüttenwarte immer mehr solcher Routen, was bei vielen Hardcore-Alpinwanderern allerdings schlecht ankommt. Der Unterschied zwischen einer markierten und einer unmarkierten Route ist vergleichbar mit jenem zwischen einer Mode-Skitour, bei der man einfach einer vorhandenen Spur folgt, und einem frisch verschneiten Gelände, das man selbständig «lesen» muss und anspuren darf.
Quelle: http://www.nzz.ch/2007/06/14/to/articleF80KA.html

 - nehme an der Süd"wand"steig befindet sich auch dort odr?? - wäre dankbar für einen kleinen Wink
- nehme an der Süd"wand"steig befindet sich auch dort odr?? - wäre dankbar für einen kleinen Wink 
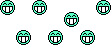





Kommentar